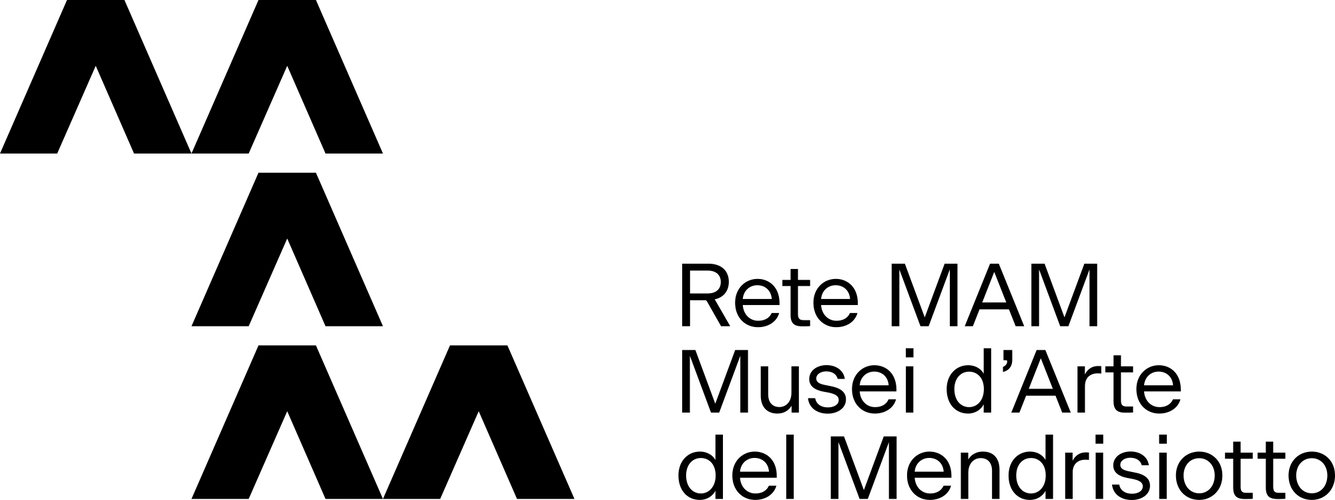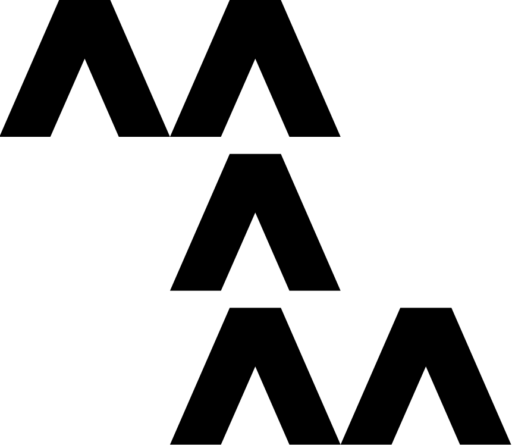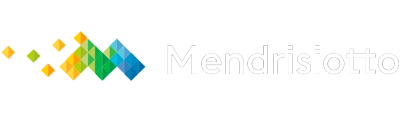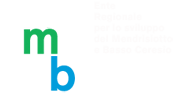Vela nach 1867, dem Jahr seiner Rückkehr in das Mendrisiotto-Gebiet
Vincenzo Vela war 1867 für immer nach Ligornetto zurückgekehrt, wo er sich neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch politisch und sozial sehr stark für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger und die besonders benachteiligten Tessiner Bevölkerungsschichten engagiert hatte. Der Bildhauer hatte sich dem Grundsatz verschrieben, in erster Linie Schweizer Bürger und dann erst Künstler zu sein und war daher von 1877 bis 1881 Abgeordneter des Grossen Rates und von 1862 bis 1877 Mitglied des Kantonsrates für Schulbildung. In dieser Rolle hat er sich vor allem für den Ausbau der Zeichenschulen eingesetzt. Vela hat sich im schulischen Bereich stets um die Errichtung einer Kunsthochschule im Tessin bemüht, was leider erfolglos blieb. Er war überzeugter Republikaner, der an «liberalen Grundsätzen ausgerichtet war» und stets seine politischen Ideale bekundet hat. Er war Mitglied in vielen Vereinen für gegenseitige Hilfe und seiner Grosszügigkeit ist es auch zu verdanken, dass das Dorf Ligornetto seine öffentlichen Infrastrukturen verbessern konnte.
Diese Grosszügigkeit war auch nach seinem Tod noch spürbar, als sein Sohn Spartaco sein Vermächtnis der Eidgenossenschaft hinterliess. Mit dem Hochrelief Opfer der Arbeit, das er 1882 aus eigenem Antrieb schuf und womit er den verunglückten Arbeitern Ehre erwies, die bei den Bauarbeiten zum Gotthard-Eisenbahntunnel ums Leben gekommen waren, schrieb Vela das Manifest der sozialen und humanitären Ansprüche.
Das Engagement Vincenzo Velas für die ärmsten Bevölkerungsschichten ruft Erinnerungen an einen weiteren Philanthropen wach, den Vela als Statue dargestellt hat, nämlich den Grafen Alfonso Turconi. Mit dem Vermächtnis des Grafen wurde in Mendrisio das Krankenhaus Ospedale della Beata Vergine errichtet, in dem heute die Accademia dell’architettura untergebracht ist. Gleich daneben steht die Einrichtung Teatro dell’architettura.
Die Bildhauertradition im Mendrisiotto und die Marmorsteinbrüche
Arzo, Besazio, Viggiù sind Orte an der Grenze in der Nähe von Ligornetto, die für ihre Steinbrüche und die unterschiedliche Beschaffenheit des Gesteins bekannt sind. Das Gebiet war die Heimat vieler Steinmetzen, Ornamentisten und Bildhauer, die oft im Ausland dem Maurerhandwerk nachgegangen sind und dann in ihrer Heimat bedeutende Spuren ihrer Handwerkskunst hinterlassen haben. Einer davon war Apollonio Pessina, der fast 40 Jahre lang Kurator unseres Museums war. Auch Vincenzo Vela wurde noch als Kind zum Erlernen des Steinmetzhandwerks in die nahegelegenen Steinbrüche geschickt. Um 1834 suchte er seinen älteren Bruder Lorenzo in Mailand auf, der dort Dekorationsbildhauer war, um in der Dombauhütte seine Lehre fortzusetzen. Die künstlerische Begabung des Bildhauers hat sich ausgehend von seinen einfachen Verhältnissen in dieser Umgebung entfaltet und wurde durch die Anlehnung an die antike Tradition der italienischen Kultur bereichert. Seine Galerie mit den Gipsmodellen (Gipsothek) sticht im Vergleich zu den bescheideneren und älteren Zeugnissen der früheren und zeitgenössischen Bildhauertradition besonders hervor. Vielleicht ist es ein Ort, der sich selbst feiert, ganz bestimmt aber ist es ein einladender Ort, der geistig bereichert und weiterbildet, da er von Beginn an für die Öffentlichkeit bestimmt war.
Das Vermächtnis wurde später der Schweizerischen Eidgenossenschaft überlassen unter der Bedingung, dort ein Museum oder eine Kunstschule einzurichten.
Zu den Werken der Gipsothek zählen der Ecce Homo, eine Marmorkopie davon befindet sich auf dem Grab von Vela im Friedhof von Ligornetto. Das Denkmal, das von seinem Sohn Spartaco und ehemaligen Schülern des Meisters ausgeführt wurde, ist anlässlich des Jubiläums zum zweihunderdsten Geburtstag des Künstlers mit grosszügiger Unterstützung der Stadt Mendrisio restauriert. In Mendrisio befindet sich ausserdem das städtische Museo d’arte.
Villa Vela im Gebiet Campagnadorna um die Mitte des 19. Jahrhunderts
Zwischen 1862 und 1866 entstand auf einem ausgedehnten, hügeligen Grundstück etwas nördlich von einem ländlichen Dorf entfernt eine beeindruckende Villa, die nach dem Entwurf von Cipriano Ajmetti, dem Architekten der Herzöge von Genua und vom Baumeister Isidoro Spinelli aus Sagno erbaut wurde. Dieser Ansitz der Familie Vela, der gleichzeitig auch Atelier und Gipsgalerie des Bildhauers war, war um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein stattliches Anwesen im Gebiet Campagnadorna, das schon bald als «Pantheon Vela» bezeichnet wurde und beim Betrachter Ehrfurcht und Staunen auslösen konnte. Der Bildhauer nahm in seinem Haus mittellose Menschen auf und teilte mit ihnen seine Speisen. Es war sicher kein Zufall, dass nach seinem Tod, als sein Sohn Spartaco das Vermächtnis hinterliess, in der Villa das erste öffentliche Museum im Tessin eingerichtet wurde (1896).
Der aus einer einfachen Bauernfamilie stammende Vela war ein Kunstgenie, er verabscheute die Landarbeit jedoch keineswegs, denn dadurch entstand ein enger Kontakt zu vielen seiner Mitbürger. Als er noch in Turin lebte, schrieb er während seines Herbsturlaubs in Ligornetto einen Brief mit den folgenden Zeilen: «In diesen beiden Urlaubsmonaten bin ich nicht mehr Künstler, sondern Bauer und Jäger». Seine Jagdhunde liess er nie aus dem Auge, fur die er eine besondere Leidenschaft empfand. In Rancate, wo sich heute die Pinacoteca cantonale Giovanni Züst befindet, besass Vela einen für den Tessin typischen Weinkeller, in dem er einen «Nektar» aufbewahrte, den er oft gemeinsam mit seinen Freunden und Kameraden trank.
Dieses vorwiegend idyllische Bild hat jedoch auch seine dunklen Seiten, denn in der Nacht des 6. März 1867 haben Unbekannte als Einschüchterung zwei Gewehrschüsse auf die Villa abgefeuert. Vielleicht handelte es sich dabei um Warnschüsse, deren Beweggründe bis heute unbekannt sind.
Die Grenze, welche die Geschichte des Mendrisiotto-Gebietes und Vincenzo Vela geprägt hat
Ligornetto liegt sehr nahe an der italienischen Grenze. Wie so oft in der Geschichte war die Grenze eher Stätte der Begegnung und des Austauschs als ein Ort der Barriere. Für Vincenzo Vela stellte die Grenze keine Trennung dar. Er war Bürger, Künstler, Schweizer Patriot, der aufgrund seiner republikanischen und liberalen Überzeugung am Sonderbundkrieg mitgekämpft hat. Er fühlte sich als Italiener, der sich freiwillig an den Aufständen des Risorgimento beteiligt hat und als Italiener empfand er sich auch wegen der künstlerischen Inspiration. Der Bildhauer hat einmal erklärt, dass die Grenze für ihn kein Hindernis darstelle: «Meine politischen Grundsätze sind Prinzipien, welche die ganze Welt betreffen und ich werde mich immer auf die Seite jenes Volkes stellen, das nach seiner Unabhängigkeit vom Fremden strebt und das auf seinem Weg hin zu Freiheit und Fortschritt voranzukommen gedenkt… ».
Es spricht sicher für sich, wenn im zentralen Raum seiner auf Schweizer Boden stehenden Villa die Geschichte der Einheit Italiens repräsentiert wird. Wenn wir im Mendrisiotto von Grenzen sprechen, führt uns dies unwillkürlich nach Chiasso, dem südlichen Tor der «Strasse der Volker», wo wir auf das m.a.x. museo stossen, dessen Wurzeln auf einen anderen Künstler zurückgehen, Max Huber aus Zug, der die Grenze als Stätte der Begegnung und des Austauschs wahrgenommen hat..
Zum Abschluss folgt noch eine heitere Geschichte. Es wird erzählt, dass Vela sich sehr gern für ein paar Stunden zur Erholung in seine Vogelfanganlage zurück zog, um ungestört Vögel zu fangen. Die Vogeljagd war in der Schweiz verboten, nicht jedoch in Italien.
Einige Meter der Vogelfanganlage lagen bereits auf italienischem Boden, die Anlage befand sich aber immer noch jenseits des Zollgebietes… Die Behörden des Königreichs sahen darin eine verzeihliche List und mögen vielleicht ein Auge zugedrückt haben, da sie sich an den Einsatz von Vela an den Kämpfen im Risorgimento erinnert haben könnten.